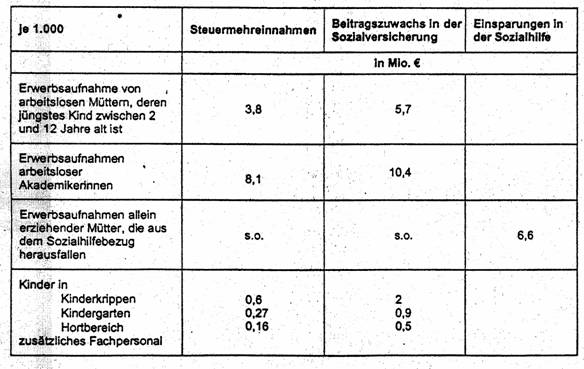Abschätzung
der (Brutto-) Einnahmeneffekte
öffentlicher
Haushalte
und der
Sozialversicherungsträger
bei einem Ausbau
von Kindertageseinrichtungen
Gutachten des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
im Auftrag des
Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Wesentliche
Ergebnisse des Gutachtens
1. Mögliche
Steuer- und Sozialversicherungsmehreinnahmen
über die
Realisierung der
Erwerbswünsche S.3
2. Mögliche
Einsparungen in der Sozialhilfe über
die
Erwerbstätigkeit allein erziehender
Mütter S.6
3.
Kinderbetreuung schafft Arbeitsplätze -
Mögliche
Steuer-
und Sozialversicherungsmehreinnahmen über
zusätzliches Personal i. den
Betreuungseinrichtungen S.7
Berlin 2002
Das Gutachten wurde
erstellt durch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW
Berlin)
Dry. C. Katharina
Spieß
Dry. Jürgen Schupp
Markus Grappa, MA.
Dry.
Joh. P. Haisken-De New Heike Jakobeit
Prüf. Dry. Gert G.
Wagner
Wesentliche
Ergebnisse des Gutachtens
Datengrundlage für
die Berechnungen zusätzlicher Steuer- und
Sozialversicherungsmehreinnahmen durch einen Ausbau der Kinderbetreuung
sind Stichproben des Sozia ökonomischen Panels (SOEP) für das Jahr 2000.
Diese Daten
enthalten Informationen über Haushaltszusammensetzungen, Erwerbs- und.
Familienbiographien, den Erwerbswunsch von Müttern, Erwerbsbeteiligung
und berufliche Mobilität. Basis für die Abschätzungen sind die
Informationen über Mütter, die nicht erwerbstätig sind, aber einen
Erwerbswunsch äußern.
Die Untersuchung
unterscheidet hier zwischen arbeitslos gemeldeten Müttern und Müttern
der so genannten Stillen Reserve". Diese wiederum teilt sich in
Personen auf, die sofort oder innerhalb des nächsten Jahres wieder
erwerbstätig sein möchten (Stille Reserve 1) und jene, die einen
Wiedereinstieg innerhalb der nächsten zwei bis fünf Jahre planen (Stille
Reserve II).
1. Mögliche Steuer-
und Sozialversicherungsmehreinnahmen über die
Realisierung von
Erwerbswünschen
Auf dieser Grundlage
wurde für alle arbeitslosen Mütter und Mütter der Stillen Reserve ein
potentielles Bruttojahreseinkommen geschätzt, das die Wünsche nach Voll-
und Teilzeit, Ausbildung, Berufserfahrung und Betriebszugehörigkeit
berücksichtigte. Die Ergebnisse erfassen die Steuermehreinnahmen sowie
die Beitrags-Mehreinnahmen für die Sozialversicherungsträger auf der
Basis der geschätzten Löhne. Es wurden die gültigen Beitragssätze der
Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung im Jahr 2000
unterstellt.
Die Untersuchung
legt bei der Abschätzung zusätzlicher Einnahmen verschiedene Varianten
zugrunde, von denen die folgenden beiden näher vorgestellt werden.
Grundsätzlich wurden nur die Personen einbezogen, die tatsächlich eine
Rückkehr in den Beruf wünschen.
-
Es werden die
zusätzlichen Einkommensteuereinnahmen und die erhöhten
Beitragseinnahmen der Sozialversicherungsträger für alle in
Westdeutschland arbeitslos gemeldeten Mütter und Mütter in der Stillen
Reserve 1 und II mit Kindern zwischen 'zwei und zwölf berechnet, deren
Kind nicht ganztägig betreut wird.
-
Alternativ erfolgt
eine Konzentration auf die akademisch ausgebildeten 'Frauen dieser
Gruppe.
Ergebnisse bei einer
Erwerbstätigkeit der Mütter mit
nicht ganztägig
betreutem Kind
Das Abstellen dieser
Variante auf die arbeitslosen Mütter und Mütter der Stillen Reserve mit
nicht ganztägig betreutem Kind erfolgt beispielhaft, um die Auswirkungen
zu veranschaulichen, die bestenfalls erreichbar sein werden, wenn diese
Gruppe arbeitswilliger Frauen eine Anstellung erhalten könnte. Auf eine
Unterscheidung nach einzelnen Berufsgruppen soll bewusst verzichtet
werden.
Da die
Erwerbswilligkeit von Müttern nach wie vor stark vom After ihres
jüngsten Kindes abhängt, wurde zur Abschätzung potentieller
Einnahmeeffekte typisierend eine Untergrenze für das jüngste Kind, von
zwei Jahren und eine Obergrenze zwölf Jahren angenommen.
Die potentiellen
Mehreinnahmen belaufen sich bei einer Erwerbstätigkeit der arbeitslosen
Mütter (121.000)1, deren jüngstes Kind noch keine
Ganztagsbetreuung in einer Kinder-tageseinrichtung nutzt, für die
öffentliche Hand auf knapp 470 Millionen , für die
Sozial-versicherungsträger auf bis zu 700 Millionen .
Die analoge Gruppe
der Mütter in der Stille Reserve l (273.000) würde zusätzliche
Steuereinnahmen von bis zu 1,1 Milliarden und zusätzliche
Beitragseinnahmen von bis zu 1,6 Milliarden erwirtschaften, sofern
alle erwerbstätig würden.
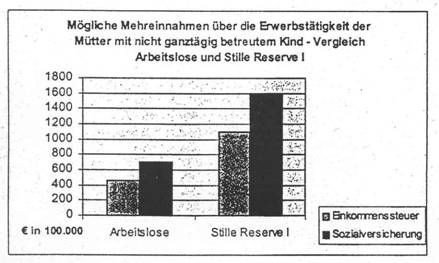
Eine
Erwerbstätigkeit aller Mütter in der Stillen Reserve II
(1.235.000) könnte knapp 4,4 Milliarden zusätzliche Steuereinnahmen
und bis zu 6,7 Milliarden zusätzliche Sozialversicherungsbeiträge pro
Jahr einbringen.
Bei einer
Erwerbstätigkeit aller drei Gruppen (1,6 Millionen) beliefen sich die
zusätzlichen Steuermehreinnahmen der öffentlichen Haushalten auf bis zu
6 Milliarden , während die Sozialversicherungsträger mit Mehreinnahmen
von bis zu 8,9 Milliarden im Jahr rechnen könnten. Es geht insgesamt
also um einen Betrag von knapp 15 Milliarden E im Jahr. Um diese
Variante zu realisieren, müssten alle zur Zeit nichterwerbstätigen
Mütter mit Kindern ohne ganztägige Betreuung erwerbstätig werden.
_________________________________________________________________
1
Die Zahl der (westdeutschen) arbeitslosen Frauen erweist sich u.a.
deshalb als erstaunlich niedrig, weil Mütter während der Elternzeit
nicht arbeitslos gemeldet sind.
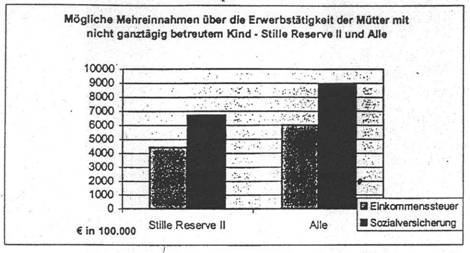
Ergebnisse bei einer
Erwerbstätigkeit der Akademikerinnen mit nicht ganztägig betreutem Kind
Vor allem für die
Akademikerinnen sind angesichts eines Fachkräftemangels die Chancen gut,
ihre Erwerbswünsche zu realisieren. Die potentiellen Mehreinnahmen
belaufen sich bei einer Erwerbstätigkeit der arbeitslosen
Akademikerinnen (19.000), deren jüngstes Kind noch keine
Ganztagsbetreuung in einer Kindertageseinrichtung nutzt, für die
öffentlichen Hand auf rd.. 160 Millionen , für die
Sozialversicherungsträger auf rd. 200 Millionen .
Die analoge Gruppe
der Akademikerinnen in der Stille Reserve I (40.000) würde
zusätzliche Steuereinnahmen von rd. 350 Millionen und zusätzliche
Beitragseinnahmen von rd. 420 Millionen erwirtschaften, sofern alle
erwerbstätig würden.
Eine
Erwerbstätigkeit aller Akademikerinnen in der Stillen Reserve II
(89.000) könnte rd. 630 Mio. zusätzliche Steuereinnahmen und rd. 770
Millionen zusätzliche Sozialversicherungsbeiträge pro Jahr einbringen.
Bei einer
Erwerbstätigkeit aller drei Gruppen (148.000) beliefen sich die
zusätzlichen Steuermehreinnahmen der öffentlichen Haushalten auf rd. 1,1
Milliarden , während die Sozialversicherungsträger mit Mehreinnahmen
von rd. 1,4 Milliarden im Jahr rechnen könnten. Es geht insgesamt also
um einen Betrag von 2,5 Milliarden im Jahr, wenn alle zur Zeit nicht
erwerbstätigen Akademikerinnen mit Kindern ohne ganztägige Betreuung
erwerbstätig werden.
2. Mögliche
Einsparungen In der Sozialhilfe über die Erwerbstätigkeit allein
erziehender Mütter
Die Berechnungen
möglicher Einsparungen über die Erwerbstätigkeit Sozialhilfe beziehender
Mütter basiert auf Stichproben der Sozialhilfeempfängerstatistik des
Jahres 1997. In das Gutachten wurden nur die allein erziehenden Mütter
mit Kindern unter 13 aufgenommen. Es ist bekannt, dass gerade allein
erziehende Mütter große Anstrengungen unternehmen, um aus dem
Sozialhilfebezug herauszukommen.
Werden ihnen
geeignete Betreuungsmöglichkeiten angeboten, ist in hohem Maße mit der
Aufnahme einer Berufstätigkeit zu rechnen.
1997 bezogen in
Westdeutschland insgesamt 244.000 allein erziehende Mütter mit Kindern
unter 13 Jahren Sozialhilfe. Unterschieden nach dem After des jüngsten
Kindes hatten 53 der Mütter Kinder im Schulalter, 32 % Kinder im
Kindergartenalter und 15 % Kinder im Alter von unter 3 Jahren.
Die Ausgaben für
diese Mütter wurden nach der Anzahl der Kinder und nach deren Alter
aufgeschlüsselt. Das Einsparpotential liegt für den Fall der
Erwerbstätigkeit der Mütter insgesamt bei rd. 1,5 Milliarden . Dabei
entfielen auf die Gruppe der Mütter mit Kindern im Krippenalter
annähernd 240 Millionen , für die mit Kindern im Kindergartenalter
annähernd 500 Millionen und für die mit einem jüngsten Kind im
Hortalter bis zu 790 Millionen im Jahr.
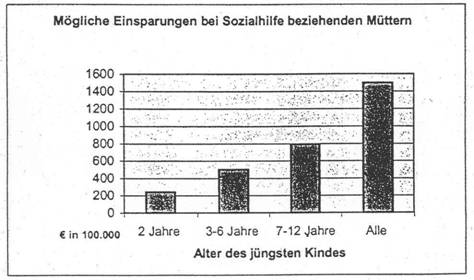
Geht man davon aus,
dass Mütter mit einem Schulabschluss eher eine Erwerbstätigkeit finden
werden, würden sich für die öffentlichen Haushalte im Bereich der
Sozialhilfe rd. 580 Millionen an Einsparungsmöglichkeiten ergeben.
Unterschieden nach dem Alter des jüngsten Kindes bedeutet dies: Der
Ausbau des Krippenbereichs brächte rd. 170 Millionen , der Ausbau des
Kindergartenbereichs rd. 310 Millionen und der Ausbau des Hortbereichs
annähernd 100 Millionen an Einsparungen.
Schließlich
berechnet das Gutachten mögliche Einsparungen im Bereich der Sozialhilfe
für die Mütter, die ihre Nichterwerbstätigkeit mit häuslicher Bindung"
begründen und infolge des Kita-Ausbaus dem Arbeitsmarkt zur Verfügung
stünden.
Wenn diese Mütter
mit Kleinstkindern einer Erwerbstätigkeit nachgegangen wären, hätten
sich Einsparungen in Höhe von rd. 130 Millionen ergeben. Bei Müttern
mit Kindern im Kindergartenalter wäre ein Betrag in Höhe von rd. 290
Millionen möglich gewesen. Bei Müttern mit Hortkindern hätten
Einsparungen in der Höhe von 370 Millionen erzielt werden können. In
der Summe beliefen sich die Einsparungen der öffentlichen Haushalte im
Bereich der Sozialhilfe durch den Ausbau von Kindertageseinrichtungen
bei einer gleichzeitigen Erwerbstätigkeit der Mütter auf 790 Millionen
.
3. Kinderbetreuung
schafft Arbeitsplätze - Mögliche Steuer- und
Sozialversicherungsmehreinnahmen über zusätzliches Personal in den
Betreuungseinrichtungen
Eine quantitativ
ausreichende und qualitativ gute Kinderbetreuung in Deutschland schafft
Arbeitsplätze. Die Untersuchung des DIW hat deshalb mögliche Einnahmen
über den Ausbau des Personals in westdeutschen Kindertageseinrichtungen
abgeschätzt. Anhand der SOEP-Daten konnten für alle arbeitslosen Mütter
und die Mütter der Stillen Reserve die Anzahl ihrer Kinder errechnet
werden, die einen Betreuungsbedarf hätten, sofern die Mutter
erwerbstätig wären. Wiederum wurde nach drei Altersgruppen der Kinder
unterschieden. Der tatsächliche Bedarf an Vollzeitkräften in Krippen,
Kindergarten und Horten wurde anhand eines Betreuungsschlüssels, der die
durchschnittliche Zahl der verfügbaren Plätze je Vollzeitstelle regelt,
berechnet. Im Hortbereich orientiert sich die Berechnung an
durchschnittlichen Personalstandards.
Zusätzlich geht die
Berechnung von der Annahme aus, dass die Mütter ihre Kinder in
Kindertagesstätten betreuen lassen und keine anderen Betreuungsformen
wie Tagesmütter wählen. Zweitens setzt sie voraus, dass auf dem
Arbeitsmarkt ausreichend Fachkräfte aus dem sozialpädagogischen Bereich
zur Verfügung stehen.
Nach 'einer
Berechnung der Kinder erwerbswilliger Mütter ohne ganztägige Betreuung
konnte die Anzahl der benötigten Fachkräfte ermittelt werden.
Demzufolge gibt es
für die Kinder der arbeitslos gemeldeten Mütter einen Bedarf bis zu
13.089 Fachkräften, für die Kinder der Mütter in der Stillen Reserve 1
einen Bedarf bis zu 55.775 Fachkräften und für die Kinder der Mütter in
der Stillen Reserve Il einen Bedarf bis zu 360.776 Fachkräften.
In der Summe sind dies bis zu 429.640 Fachkräfte, die für einen
bedarfsgerechten Ausbau der Krippen, Kindergärten und Horte benötigt
würden.
Würden die Kinder der vormals arbeitslosen Mütter in einer
Kindertagesstätte betreut, ergäben sich mit der Einstellung dieser
zusätzlichen Fachkräfte rd. 39 Millionen E an möglichen
Steuermehreinnahmen. Die Fachkräfte, die zur Betreuung der Kinder von
Müttern der Stillen Reserve 1 eingestellt würden, erwirtschafteten rd. 127
Millionen , im Bereich der Stillen Reserve II wären dies rd. 1,1
Milliarden . Insgesamt beträgt das Potential an möglichen
Steuermehreinnahmen rd. 1,2 Milliarden .
Dementsprechend sehen die zusätzlichen Beitragseinnahmen der
Sozialversicherungsträger folgendermaßen aus. Für den Fall der
Erwerbstätigkeit de( arbeitslosen Mütter beliefen sich die
Beitragseinnahmen der zusätzlich eingestellten Fachkräfte auf rd. 130
Millionen , bei der Stillen Reserve I auf rd. 570 Millionen , bei
der Stillen Reserve II auf rd. 3,7 Milliarden . Insgesamt ergäben dies
rd. 4,4 Milliarden zusätzliche Beitragseinnahmen der
Sozialversicherungs-träger.
Insgesamt bewegen sich die möglichen Mehreinnahmen durch den Ausbau der
Kindertageseinrichtungen sowohl im Bereich der Einkommensteuer als auch im
Bereich der Sozialversicherung in Milliardenhöhe.
Die Wirkungen des Ausbaus der Kindertagesbetreuung sind stark von der
Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes abhängig. Das Gutachten erlaubt es,
Wirkungen alternativer Annahmen je 1.000 Personen aufzuzeigen: